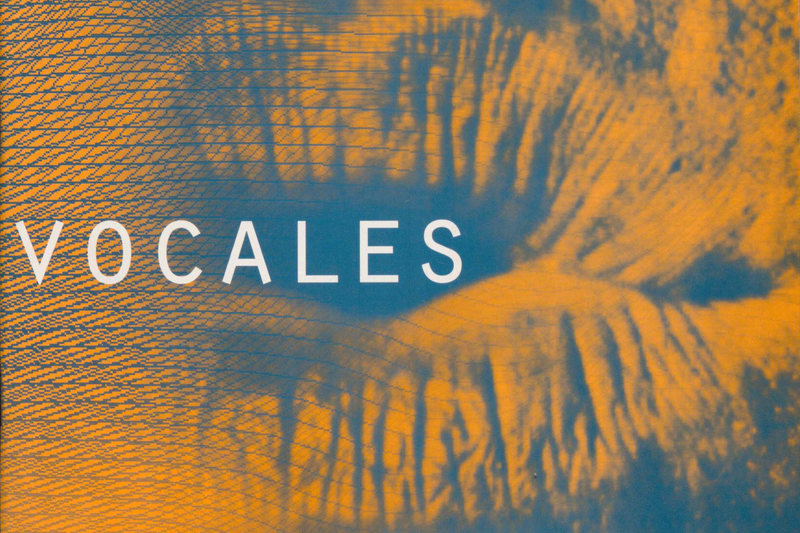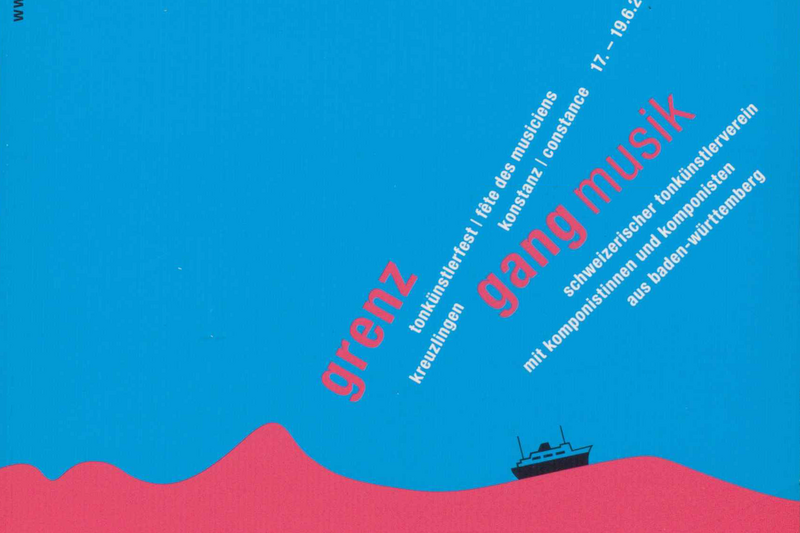Die Tonkünstlerfeste 1975–2017 in Zahlen und Namen
Zu den attraktivsten Aktivitäten und Förderinstrumenten des STV zählten die jährlich unter beträchtlichem Aufwand ausgerichteten Tonkünstlerfeste. Zusammen mit den zumeist gleichzeitig anberaumten Generalversammlungen bildeten sie den zentralen Fixpunkt im Vereinskalender. Ein Überblick über die 42 Feste, die zwischen 1975 und 2017 über die Bühne gingen – 1995 verzichtete man aus organisatorischen Gründen auf eine Austragung –, findet sich hier.
Verzeichnet sind über 30 unterschiedliche Austragungsorte; Städte wie Basel, Luzern oder Genf kamen mehr als einmal zum Zug. 21 Feste, also 50 %, fanden in der Deutschschweiz statt, 13 in der Suisse romande, 2 im Tessin, 6 an zweisprachigen Orten (deutsch/französisch bzw. deutsch/rätoromanisch).
Die Feste waren Orte der Vernetzung, des geselligen Beisammenseins und des debattierenden Austauschs. Insbesondere aber boten sie den Mitgliedern Gelegenheit, das eigene Schaffen zu präsentieren. Das Gesamtrepertoire des Zeitraums 1975 bis 2017 haben wir in einer Datenbank erfasst. Die Zahlen, die diese Auflistung zutage fördert, sind eindrücklich:
• Die Summe aus Kompositionen von Vereinsmitgliedern sowie Improvisationen (solo, im Duo oder Kollektiv), Performances und Klanginstallationen, an denen mindestens ein STV-Mitglied beteiligt war, ergibt ein Total von über 1000 Aufführungen.
• Rund 250 der Kompositionen erlebten an einem der Feste ihre Uraufführung und etwa 20 Installationen wurden eigens für einen der Austragungsorte konzipiert.
• Hinzu kommen zahlreiche Aufführungen von Werken aus aller Welt und verschiedenen Jahrhunderten, die immer wieder in die Programme eingestreut wurden.
• Etliche weitere Beiträge ergänzten die musikalisch-künstlerischen Darbietungen: Workshops, musikpädagogische Demonstrationen, Symposien oder Einzelreferate, Podiumsgespräche, Lesungen oder Filmvorführungen.
Wie aber hat man die jeweiligen Programminhalte überhaupt bestimmt? Für rund 75 Prozent der Tonkünstlerfeste wurde im Vorfeld ein Wettbewerb lanciert, der in der Regel einem Standardprozedere folgte: Etwa zwei Jahre vor einem Fest erging eine Ausschreibung an die Vereinsmitglieder, welche die Art (Besetzung, Dauer etc.) der erwünschten Beiträge umriss. Eine traditionell siebenköpfige Jury, die jährlich neu gewählt wurde und zu der sich Beisitzer:innen mit beratender Stimme gesellen konnten, prüfte anschliessend die Kandidaturen und wählte die aufzuführenden Beiträge aus. Drei Jurymitglieder wurden vom Vorstand gestellt, vier von der Generalversammlung gewählt. Die Deutschschweiz war zumeist mit vier, die lateinische Schweiz (in erster Linie die Suisse romande) mit drei Stimmen vertreten. Dieses Wettbewerbsmodell wurde im Laufe der Jahre allerdings verschiedentlich modifiziert, und nicht selten verzichtete man überhaupt auf eine Ausschreibung und überliess die Programmgestaltung einem Kuratorium.
Wer waren die Meistgespielten, inwiefern bildete sich so etwas wie ein «Kanon» der Tonkünstlerfeste? Nimmt man die Feste von 1975 bis 2017 pauschal in den Blick, so ergibt sich eine «Rangliste», die von Klaus Huber angeführt wird. Ihm folgen Urs Peter Schneider, Rudolf Kelterborn, Heinz Holliger und Alfred Zimmerlin (ex aequo Platz 4) sowie Michael Jarrell und Eric Gaudibert (Platz 5).
Diese Liste ist jedoch nicht viel mehr als eine Spielerei. Was sie vernachlässigt, ist nämlich die Frage, ab wann jemand Vereinsmitglied war, an den Festen also überhaupt aufgeführt werden konnte. Wird diese Frage mitberücksichtigt, ergibt sich ein anderes Bild. Um ein markantes Beispiel herauszugreifen: Dieter Ammann belegt übers Ganze gesehen Rang 8, trat dem Verein jedoch erst 1997 bei und erzielte seine 10 Aufführungen anschliessend in nur 14 Jahren (1999–2013). Demgegenüber erstreckten sich Klaus Hubers 18 Aufführungen über 37 Jahre (1975–2012). Bezüglich der Aufführungsdichte in einem gegebenen Zeitraum wird Huber also von Ammann geschlagen.
Wo aber bleiben hier die Frauen? [siehe auch Frauen im STV]
Ihre Teilhabe am Gesamtrepertoire (also den über 1000 Aufführungen) beträgt gerade einmal 16 Prozent. Bis Ende der 1980er-Jahre waren sie nahezu unsichtbar. Ab 1990 zeichnete sich eine leichte, ab 2000 eine deutlichere Verbesserung der Verhältnisse ab. Im 21. Jahrhundert (2000–2017) beträgt der Frauenanteil am Repertoire dann durchschnittlich 20 Prozent. In dieser Entwicklung spiegelt sich zweierlei: Zum einen war ab der Jahrtausendwende ein kontinuierlicher Zuwachs an Komponistinnen im Verein zu verzeichnen, der sich auch in den Programmen der Tonkünstlerfeste niederschlug. Zum andern hatten sich die Feste mit der nun einigermassen regelmässigen Einbindung von improvisierter Musik [siehe auch Integration der Improvisation], Performances und Installationen künstlerischen Bereichen und Formaten geöffnet, an denen Frauen überproportional partizipierten. Fragt man auch hier nach den Meistaufgeführten über den gesamten Zeitraum (1975–2017) hinweg, ergibt sich ebenfalls eine «Rangliste».
Die Zahlen können, pauschal betrachtet, mit der Liste der meistgespielten Männer («Ränge» 1 bis 10) erwartungsgemäss nicht mithalten. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Fragt man – wie oben am Beispiel Dieter Ammanns – danach, in welchen Zeiträumen die jeweiligen Aufführungen stattfanden, so wird der vermeintliche Spitzenreiter Klaus Huber von Isabel Mundry, Helena Winkelman und Junghae Lee überflügelt.