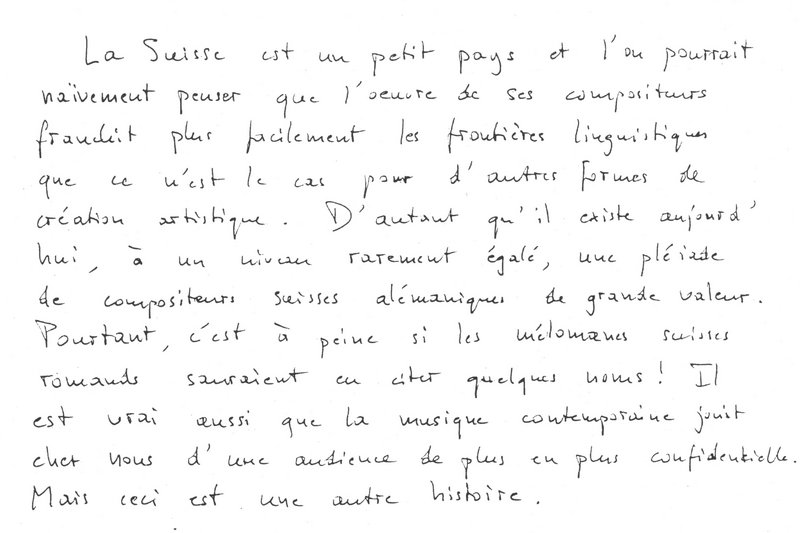Kulturschocks und Koexistenz
Der STV war immer bemüht, das labile Gleichgewicht zwischen den Kulturen zu wahren und das gegenseitige Interesse zu fördern. Präsidenten wechselten im Turnus zwischen Deutschschweiz und Suisse romande, im Vorstand gab es eine garantierte Minderheitenvertretung, in Zeitschrift, Festen und CDs versuchte man sich im Ausgleich.
Konflikte gab es kaum: «Auf der Ebene der Ästhetik konnten wir uns einigen, aber auf der Ebene der Funktionsweise des Vorstands hatte ich die Schwierigkeit, dass die Romandie im Vergleich zur Deutschschweiz zu schwach war», meint der frühere Präsident Nicolas Bolens. Den durch den STV ermöglichten Austausch schätzte er sehr: «Die Positionen konnten sehr unterschiedlich sein, aber es ging auch darum, Respekt zu lernen. Die Denkweisen, die Arbeitsweisen sind nicht unbedingt die gleichen, was uns zu einem Dialog innerhalb desselben Landes zwang. Es gab kulturelle Begegnungen, ja Kulturschocks. Und ich finde das wichtig für den nationalen Zusammenhalt. Das macht die Momente des Dialogs aus, der Begegnung.»
Diese Klammerfunktion des STV war sehr wichtig, gerade, weil sonst der innerschweizerische Austausch kaum gepflegt wurde, wie Bolens’ Vorgänger Ulrich Gasser kritisch vermerkt: «Die Romands haben keine Deutschschweizer Musik aufgeführt und umgekehrt wahrscheinlich auch. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger. Aber das war natürlich immer so. Und die Romands versteht man ja ein bisschen auch. Als Minderheit haben sie nur versucht, möglichst viel herauszuholen für sich, und das ist ihnen auch weitgehend gelungen.»
Der nächste Westschweizer Präsident, der Genfer William Blank, gehört zu den wenigen Komponisten und Dirigenten, die in beiden grossen Sprachregionen präsent sind. Auch er hält die Förderung dieser Balance für eine der zentralen Aufgaben des STV: «So musste man immer auf ein Gleichgewicht achten, auch mit der italienischen Schweiz, auf ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Regionen, damit innerhalb der Zeitschrift diese verschiedenen Sichtweisen vertreten waren, aber auch bei der Ausarbeitung der Musikfeste, dass es auch eine angemessene Vertretung der verschiedenen Musiken (im Plural) gab.»
Der STV bemühte sich darum, die unterschiedlichen Kulturen im fremden Sprachbereich bekannt zu machen, einerseits mit den Tonkünstlerfesten in wechselnden Regionen, aber auch mit privaten Aktionen. Jean Balissat ging mit gutem Beispiel voran, indem er Hans Ulrich Lehmann am Conservatoire Genf mit kommentierten Porträtveranstaltungen vorstellte, auch wenn sich die beiden ästhetisch denkbar fernstanden.
Alle hierzu befragten Zeitzeugen – William Blank, Roman Brotbeck, Alfred Zimmerlin, Daniel Fueter, Matthias Arter, Ulrich Gasser – konstatieren einen unterschiedlichen Umgang mit Klang und Geräusch, Konstruktion, Virtuosität und Eleganz, im Sprechen und im Denken. Sie führen dies auf unterschiedliche Traditionen, Vorbilder und Diskurse zurück. Gleichzeitig wird häufig aber auch die Membran betont, die Durchlässigkeit, der Austausch.
Einig sind sich praktisch alle Zeitzeugen, dass die Nachbarländer die kulturellen Unterschiede stark beeinflusst haben – und zwar auf die verschiedensten Ausdrucksweisen der Musik, wie Alfred Zimmerlin anmerkt: «Man ist ja auch wirklich umschlossen von Frankreich, so ein klein wenig Italien als Grenze. Und dann die deutsche Schweiz. Von daher ist da schon ein kultureller Unterschied zu merken. Man kann den Fossé du Rösti nicht wegleugnen. Das ist sicher im STV auch der Fall. Und man merkt, dass sich die deutsche Schweiz kulturell eher Richtung Deutschland, Österreich ausrichtet. Wobei ich finde das gar nicht so stark. Ich finde, dass in der deutschen Schweiz durchaus auch ein Bewusstsein für das Romanische da ist. Also es hängt sicher auch mit den Italienisch-Gastarbeitern zusammen. Und einen Blick nach Frankreich gestattet man sich auch, viel mehr als in Deutschland. […] Also. Da ist vielleicht auch dann das Kleinstaatverhalten.» Blank stimmt dem zu: «Ich denke, dass es Einflusszonen gibt durch Affinität, der Komponist bezieht sich mehr auf sie als auf andere – und das ist es, was wir meiner Meinung nach beibehalten sollten, in der Koexistenz.»